| Historisches aus der Bittermark! |
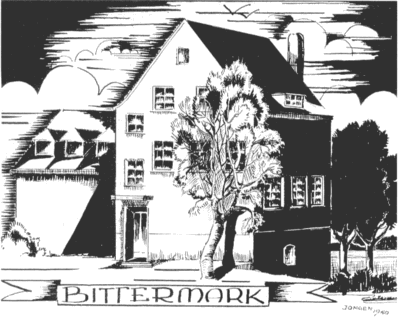 |
| Die Bittermark war über Jahrhunderte eine der Waldmarken und
umfaßte um 1770 eine Fläche von ca. 161 ha. Sie wird begrenzt durch die heutige Hagener
Strasse, durch die Kirchhörder Strasse, durch die Reichsmark im Süden und durch die
Hacheneyer Mark im Osten. Erst nach 1770 begann eine erste zaghafte Besiedlung der Bittermark durch das Rohden von Waldflächen und Erbauung von kleinen Kotten. Durch die abgeschiedene Lage der Bittermark entwickelten sich bei den Bewohnern eigenständige Sitten und Gewohnheiten, die bei einigen Nachkömmlingen noch bis heute nachwirken. Die Eigenständigkeit der Bittermark ging zeitweise so weit, daß man auch von einer "Republik Bittermark" sprach. Die Historie der Bittermark ist seit 1929 auch eine Historie der Stadt Dortmund, da in diesem Jahr der Verwaltungsbezirk Wellinghofen, zu dem die Bittermark seinerzeit gehörte, nebst weiteren südlichen Gemeinden von der Stadt Dortmund "eingemeindet" wurden. In früheren Zeiten gehörte die Bittermark zum Kirchspiel Kirchhörde. Seit 1975 gehört die Bittermark zum Dortmunder Bezirk Hombruch und weist bei
einer Fläche von Die Stadt Dortmund wird urkundlich zum erstenmal in dem Zeitraum von 880 bis 890 in einer Urkunde (siehe auch nachfolgende Abbildung mit dem betreffenden Ausschnitt aus dieser Urkunde) als "Throtmanni" erwähnt. In den rund 200 Jahren danach treten auch die Schreibweisen "Trutmunia", "Trutmenni", "Thortmanni", "Trutmonia" und die lateinische Form "Tremonia" auf. Es gibt Historiker, die die Ortsbezeichnung als "Drei-Mauern"-Befestigung interpretieren. Ab dem 11ten Jahrhundert trat parallel auch die deutsche Schreibweise "Dortmund" auf.
|
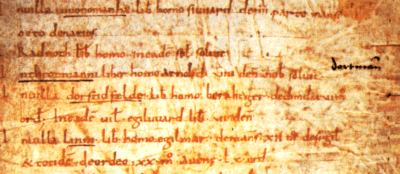 |
| Dortmund entwickelte sich an einem Kreuzungspunkt von wichtigen Handelswegen, wie auch dem bekannten Hellweg. An den markierten Stellen wurden vermuteterweise zunächst Burgen gebaut, aus denen sich ein Königshof und dann ein Grafenhof entwickelte. |
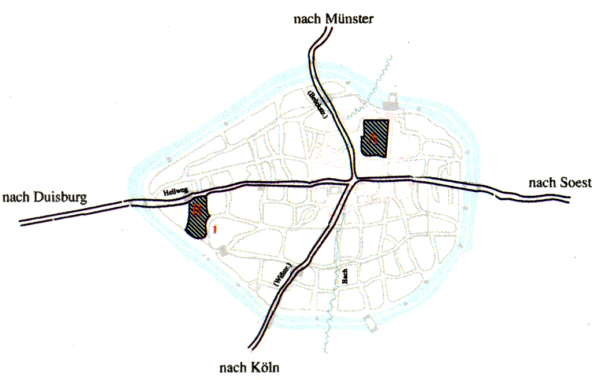 |
| Ein weiteres wichtiges Datum in der Geschichte der Stadt Dortmund war die Übertragung des Bierbrau-Privilegs durch König Adolf von Nassau am 22. August 1293, was auch in der nachfolgend dargestellten Urkunde dokumentiert ist. |
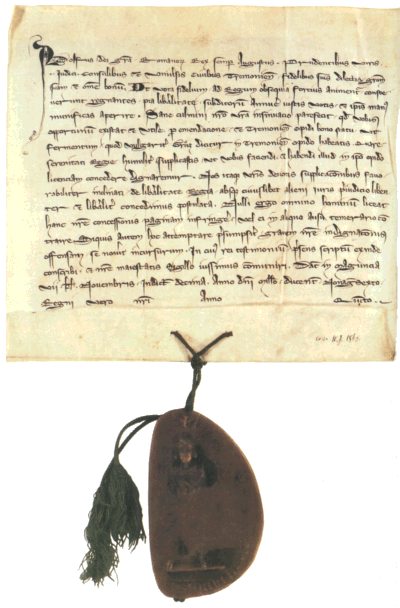 |
| Der sich entwickelnde Dortmunder Stadtbereich war noch bis zum Mittelalter weit von der jetzigen Bittermark entfernt. Diese Entwicklung zeigt die nachfolgende Abbildung. |
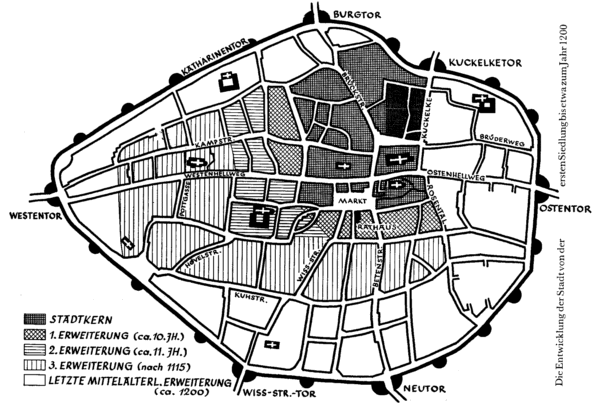 |
| Im Mittelalter gehörte die Bittermark zum "Amt Hoerde" und war mit seinen wenigen Einwohnern und umso mehr Wald eine ziemlich unbedeutende Gemarkung, die auch in einer Karte von 1791 noch nicht explizit dargestellt wird. |
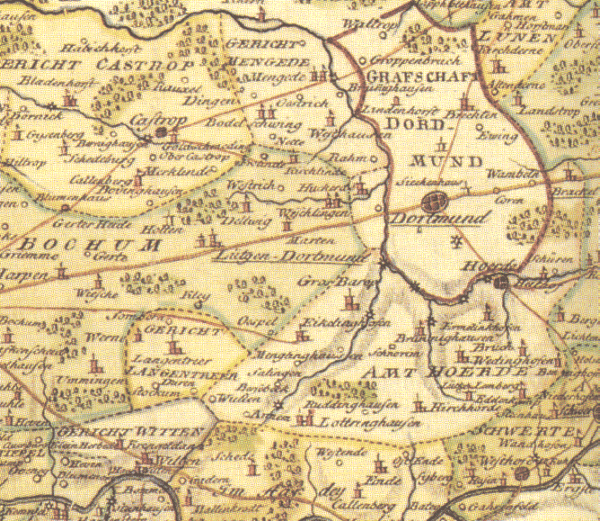 |
| Die Bebauung der Bittermark um 1900 ... |
 |
| ... und die Bebauung heute! |
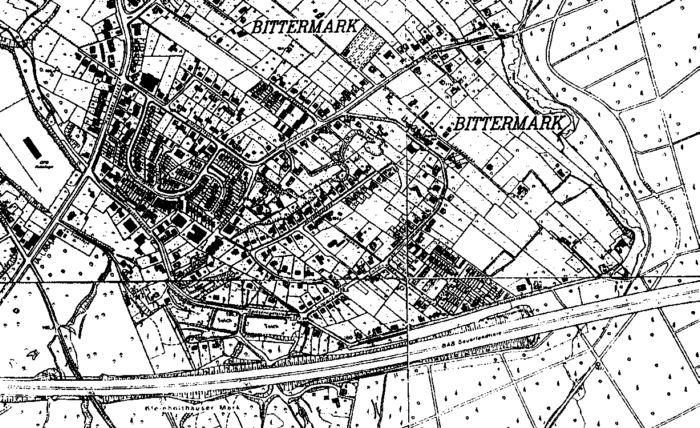 |







